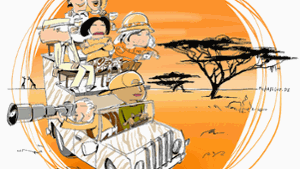Der eine bucht einen Jeep samt Guide für sich allein, der andere cruist mit dem Landrover durch die Steppe - als Selbstfahrer. Eine Typologie.
Der Hardcore-Safarista
Er drängt darauf, morgens um 5 Uhr zum „Morning-Drive“ rauszufahren. Er will die Elefanten im frühen Licht sehen, wenn noch Tau auf den Gräsern liegt. Mit Geduld und mildem Lächeln erfüllt der Lodge-Manager ihm seinen Wunsch. Am ersten Morgen. Denn er weiß ja, damit hat es sich erledigt. Denn was der Hardcore-Safarista noch nicht weiß: Um 5 Uhr ist es in den Ländern in der Nähe des Äquators zappenduster. Mag sein, dass da die Leoparden auf der Lauer liegen - doch man sieht sie nicht. Eine Untergruppe der Hardcore-Safaristas bildet der Ausgestattete. Er reist komplett neu eingekleidet an. Hat sich Schuhe, Hosen, Shirts und einen Hut gekauft. Die Outdoor-Läden seiner Stadt arbeiten mit guten Verkäufern. Allein: All seine Kleidung ist zu lang, zu warm, zu wasserabweisend. Er gart im eigenen Saft. „Frischfleisch“, sagen die Angestellten der Lodge.
Der Fotograf
Am liebsten bucht der Fotograf einen Jeep samt Guide für sich allein. Dann kann er diesen kleinen Vogel mit den blauen Federn und dem gelben Schnabel, dessen Namen er auf Englisch, Latein und Suaheli weiß, ausgiebig fotografieren. Wenn es der Guide erlaubt, steigt der Fotograf aus. Dann steht er wie ein Baobab in der Landschaft, die Kamera geschultert. Das Objektiv groß wie eine Panzerabwehrrakete. So ein Rohr. Sein Dasein hat etwas Martialisches. Das Klicken der Kamera klingt wie Maschinengewehrfeuer. Rattattattattat. Mit den sozialen Netzwerken hat das Fotografieren auch auf Safaris zugenommen. Am liebsten wäre den Gästen ein Jeep mit WLAN, um das Löwenfoto sofort auf Facebook posten zu können. Da rümpft der Fotograf die Nase. Er hat kein Smartphone. Er knipst nicht, er fotografiert.
Das Paar
Ein Lodge-Betreiber charakterisiert das Paar so: „Safari war immer mein Lebenstraum“, sagt er. Sie sagt (im Jeep): „Dauert es noch lang?“ Abends, beim Weinglas-Kling-Klang auf der Terrasse, fügt sie hinzu: „Ich hab meinen Mann noch nie so relaxed gesehen.“ Am ersten Tag laden alle andauernd ihre Smartphones, Tablets, Computer auf. Irgendwann vergessen sie es fast. Die Männer haben Listen, sagt der Lodge-Betreiber. Und sie sagen morgens zum Fahrer: „Ich will einen Löwen, eine große Antilope und diesen grünen Vogel.“ Der Fahrer sagt: „We will see.“ Das bedeutet alles und nichts. Dann gibt es noch das abenteuerlustige, junge Paar, das mit dem Landrover durch Sambia fährt. Als Selbstfahrer. Klingt nach einer tollen Reise „out of Africa“. In den Dörfern unterwegs angehalten, mal in einer Bar eine Cola getrunken. Irgendwo übernachtet. „Nein, nein“, sagt der junge Mann, der immer am Steuer saß, „wir haben alle Nächte vorgebucht. Wir halten nie an, wir fahren von Lodge zu Lodge.“
Die Achtsame
Sie sitzt im Jeep. Aber sie sitzt da nicht gerne. Da ist dieser Leopard auf dem Baum. Der Fotograf und das Paar haben schon Hunderte von Bildern geschossen. Und der Jeep steht immer noch da, fährt nicht los. Später dasselbe Programm mit Löwen. Eine Löwen-Sippschaft räkelt sich im Schatten unter einem Baum. Die Achtsame will weg. „Können wir jetzt bitte fahren?“ Sie brauche keine Angst zu haben, sagt der Guide. Sie habe keine Angst, sagt sie. Sie habe nur das klare Gefühl, nicht dazu berechtigt zu sein, hier zu sein, den Tieren so auf die Pelle zu rücken. „Es ist ihr Habitat, nicht meiner“, sagt sie. Warum könne man sie nicht einfach in Ruhe lassen? Jeder hier habe die Tiere doch nun lange angeschaut. Als es endlich weitergeht, sagt sie: „Ich hasse Leute, die fotografieren.“
Der Martin
In seinem anderen Leben ist der Martin Bankdirektor oder Manager eines Konzerns. Der Martin kann auch Hans oder Holger heißen. Der Martin ist es gewohnt, alles zu kontrollieren. Er hat es auf Safari schwer. Denn er kann hier nichts kontrollieren. Er muss allen Anweisungen des Safari-Guides Folge leisten. Das ist der Martin nicht gewöhnt. Jetzt hat der Martin die Möglichkeit, sich einfach fallen zu lassen, wenn er das kann. Runterkommen von seinem durchgetakteten Alltag und vielleicht eine Erkenntnis mit nach Hause bringen: Panta rhei, alles fließt. Oder auf die Safari bezogen: Alles rennet, rettet, flüchtet. Das Leben ist ein Fressen und Gefressenwerden, nicht nur an der Börse, auch im Busch. Mit dieser Erkenntnis kann der Martin die Angst vor dem Tod verlieren. Und erkennen, dass er auch dann, wenn er nicht in der Kluft des Bankdirektors steckt, wenn er nicht Chef ist, ein Mensch ist. Manchmal geht von dem Martin aber auch Gefahr aus. Er ist der Typ, der zu Selbstüberschätzung neigt und zum Guide sagt: „Ich war schon mal in Afrika, ich kenne mich aus.“ Wenn der Martin dann Alkohol trinkt - „Ich weiß, wie viel Gin Tonic ich vertrage!“ -, sieht er es nicht ein, warum er nachts nicht allein ums Zelt gehen darf. Das ist dann schlecht für den Martin.
Fan werden auf Facebook: https://www.facebook.com/fernwehaktuell